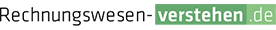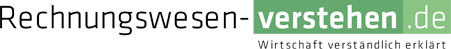Bürgschaft
Bürgschaft verständlich & knapp definiert
Eine Bürgschaft dient dazu, ein Vertragsgeschäft abzusichern. Denn der Bürge haftet für den Fall, dass der Hauptschuldner des Vertrags seinen Leistungen nicht nachkommen kann. Insbesondere bei Kreditgeschäften kommt diese Sicherheit in Form der selbstschuldnerischen Bürgschaft zum Einsatz.- chevron_right Abschluss einer Bürgschaft
- chevron_right Ausfallbürgschaft und selbstschuldnerische Bürgschaft
- chevron_right Bürgschaft – Definition & Erklärung – Zusammenfassung
Ist die Bonität eines Kreditnehmers aus Sicht einer Bank für die Gewährung eines Kredites nicht ausreichend, kann sie eine Bürgschaft verlangen. Ist das der Fall, existiert eine bürgende Person, die im Falle von Rückzahlungsschwierigkeiten rechtlich in gleichem Maße einsteht, wie der ursprüngliche Kreditnehmer selbst.
Die Bank kann bei Bedarf direkt an den Bürgen herantreten und zur Zahlung der ausgebliebenen fälligen Zahlungen auffordern. Auch bei Fälligstellung des Darlehens, also der Rückforderung des gesamten Restbetrages, ist der Bürge rechtlich ebenso in der Haftung wie der eigentliche Darlehensnehmer.

Abschluss einer Bürgschaft
Vergeben Banken ein Darlehen, so besteht hierfür ein gewisses Ausfallrisiko. Daher prüfen Kreditinstitute die Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers bereits im Vorfeld der Kreditvergabe, um einschätzen zu können, wie wahrscheinlich ein Ausfall der Forderung ist. Kommt die Bonitätsprüfung zu dem Ergebnis, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch ist, verlangt die Bank entweder einen hohen Zins für den Kredit oder entscheidet sich sogar gegen die Kreditvergabe. Verhindern kann der Kreditnehmer meist nur, indem zusätzliche Kreditsicherheiten hinterlegt werden.
Eine solche Sicherheit ist eine Bürgschaft. Wird diese abgeschlossen, so erklärt sich eine dritte Partei dazu bereit, für die Schulden des Kreditnehmers einzutreten, wenn dieser seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Allerdings wird die Bank die Bonität des Bürgen ebenfalls überprüfen. Nur wenn die Kreditwürdigkeit ausreichend hoch ist, wird die Bürgschaft als Kreditsicherheit akzeptiert.
Ausfallbürgschaft und selbstschuldnerische Bürgschaft
Das BGB sieht unterschiedliche Formen der Bürgschaft vor, wobei vor allem die Ausfallbürgschaft und die selbstschuldnerische Bürgschaft zum Einsatz kommen:
- Selbstschuldnerische Bürgschaft: Wenn ein Bürge selbstschuldnerisch haftet, so ist er dem eigentlichen Kreditnehmer praktisch gleich gestellt. Die Bank kann die Begleichung einer offenen Schuld direkt vom Bürgen einfordern, wenn der Hauptschuldner eine Kreditrate nicht bezahlen kann. Es ist nicht notwendig, ein Mahnverfahren oder gar eine Zwangsvollstreckung durchzuführen.
- Ausfallbürgschaft: Hingegen haftet der Ausfallbürge nur dann, wenn die Bank alle Rechtsmittel gegen den Hauptschuldner erwirkt hat. So muss sie ein Mahnverfahren vollziehen und sogar die Zwangsvollstreckung einleiten. Erst wenn diese nicht zur Begleichung der kompletten Restschuld führt, kann der Bürge belangt werden.
Aus Sicht des Bürgen ist die Ausfallbürgschaft mit deutlich weniger Risiken verbunden. Für die Bank stellt diese Bürgschaft jedoch keine zufriedenstellende Art der Kreditsicherheit dar. Zu groß ist der Aufwand, die Schuld tatsächlich vom Bürgen eintreiben zu können. Im Rahmen von Krediten werden daher fast immer selbstschuldnerische Bürgschaften abgeschlossen.
Bürgschaft – Definition & Erklärung – Zusammenfassung
- Eine Bürgschaft sichert in der Regel ein Kreditgeschäft ab
- Dabei haftet der Bürge bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners für dessen Verbindlichkeiten
- Bei der Ausfallbürgschaft muss die Bank erst alle Rechtsmittel gegen den Hauptschuldner ausschöpfen, bevor der Bürge haftet
whatshot Beliebteste Artikel
- chevron_right Selbstschuldnerische Bürgschaft
- chevron_right Disagio
- chevron_right Hypothek
- chevron_right Abzahlungsdarlehen
- chevron_right Kreditor
- chevron_right Dokumenteninkasso
- chevron_right Geldschöpfungsmultiplikator
- chevron_right Fremdkapitalzinsen
- chevron_right Effektivzins
- chevron_right Effektivverzinsung