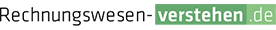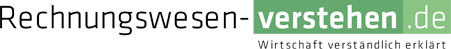Die Privatinsolvenz – ein Weg aus der Schuldenfalle
- chevron_right Die Privatinsolvenz – kurze Übersicht
- chevron_right Die Voraussetzungen für eine Privatinsolvenz
- chevron_right Was passiert beim Besuch einer Schuldenberatungsstelle?
- chevron_right Die Pflichten und Rechte während der Privatinsolvenz
- chevron_right Der außergerichtliche Einigungsversuch
- chevron_right Die Wohlverhaltensphase – was genau ist das?
- chevron_right Die Restschuldbefreiung – der Start in eine schuldenfreie Zukunft
- chevron_right Beispiel einer zusätzlichen Kostenentstehung:
Dieser Beitrag ist dazu gedacht, verschuldete Menschen zu ermutigen, den Weg in ein neues und vor allem schuldenfreies Leben zu beschreiten.
Die Privatinsolvenz – kurze Übersicht

Die Voraussetzungen für eine Privatinsolvenz
Oftmals scheitert der Antrag auf eine Privatinsolvenz an dem Gedanken, dass der Schuldner über ein regelmäßiges Einkommen verfügen muss, um überhaupt eine Privatinsolvenz beantragen zu können. Diese Information ist schlichtweg falsch. Die meisten Fälle von Verschuldung sind auf einen Verlust des Arbeitsplatzes zurückzuführen und selbstverständlich kann man auch als Arbeitssuchender eine Verbraucherinsolvenz beantragen.Folgende Personengruppen dürfen die Privatinsolvenz beantragen:
- Arbeitnehmer
- Beamte
- Kleinunternehmer nach § 19 UStG
- ALG I / ALG II Berechtigte
- Rentner
- Hausfrauen
Es ist eine weitere wichtige Voraussetzung, dass der Schuldner nicht selbstständig tätig ist und wenn, dann nur als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 UstG. Wer momentan arbeitslos beziehungsweise arbeitssuchend gemeldet ist und vor dieser Zeit umsatzsteuerpflichtig selbstständig tätig war, darf nicht über mehr als 19 Gläubiger verfügen. Anderenfalls ist das Ausweichen auf eine Regelinsolvenz notwendig, was jedoch ein anderes Verfahren als die Privatinsolvenz darstellt.
Was passiert beim Besuch einer Schuldenberatungsstelle?
Wenn sich der Schuldner dazu entschließt, ein Privatinsolvenzverfahren in die Wege zu leiten, sollte er zu Beginn eine Schuldenberatungsstelle aufsuchen. Zuvor muss der Schuldner Kontakt zu allen Gläubigern aufnehmen und diese darüber informieren, dass er sich an eine Schuldenberatungsstelle wendet und eine Privatinsolvenz durchzuführen beabsichtigt. Im gleichen Zug stellt er alle Zahlungen an die Gläubiger ein und eröffnet schnellstmöglich ein so genanntes P-Konto. Dieses spezielle Konto ist ein Pfändungsschutzkonto und sichert den künftigen Lebensunterhalt des Schuldners.Nachdem der Schuldner sich bei allen Gläubigern gemeldet hat, trifft er sich mit seinem Schuldenberater und legt ihm alle Einkünfte, Schulden und sonstige Verpflichtungen offen. In diesem Zuge kann der Schuldenberater meist bereits grob einschätzen, ob sich die Beantragung einer Privatinsolvenz lohnt und kann dem Schuldner seinen zukünftigen Selbstbehalt, also den Betrag über den der Schuldner monatlich frei verfügen darf, mitteilen. Danach setzt sich der Schuldenberater mit den Gläubigern in Verbindung und startet einen letzten außergerichtlichen Einigungsversuch. Dafür ermittelt er, wie viel der Schuldner monatlich für die Begleichung seiner Lasten zur Verfügung hätte und teilt dies auf die vorhandenen Gläubiger auf. Sind die Gläubiger mit dem Angebot des Schuldenberaters einverstanden, entfällt die Beantragung der Privatinsolvenz. Anderenfalls wendet sich der Schuldner an das örtliche Amtsgericht, legt dort seine wirtschaftliche und persönliche Situation offen und beantragt eine Privatinsolvenz.
Sollte sich übrigens einer der Gläubiger nicht mit der Durchführung des Verfahrens einverstanden erklären, besteht die Möglichkeit, dieses Einverständnis gerichtlich zu erzwingen.
Die Pflichten und Rechte während der Privatinsolvenz

Auf der anderen Seite muss der Schuldner sich um eine Arbeitsstelle bemühen und darf keine eigenmächtigen Zahlungen an die Gläubiger leisten und so einzelne bevorzugen. Falls die Arbeitsstelle gewechselt wird oder ein Umzug ansteht, muss sich der Schuldner umgehend bei Gericht melden und die Änderungen mitteilen. Im Allgemeinen müssen alle wirtschaftlichen und persönlichen Änderungen vor Gericht angegeben werden. Ebenso verhält es sich, wenn der Schuldner beispielsweise eine Erbschaft annimmt. In diesem Falle wird das hälftige Vermögen gepfändet und an die Gläubiger verteilt.
Der außergerichtliche Einigungsversuch
Der außergerichtliche Einigungsversuch findet entweder zwischen Schuldner und Gläubigern oder zwischen dem Schuldenberater und den Gläubigern statt. Hierbei ist es auch möglich, dass die Gläubiger einen Einigungsversuch mit dem Schuldner direkt ablehnen, jedoch auf die Aufforderung eines Schuldenberaters reagieren und hier dem außergerichtlichen Einigungsversuch zustimmen. Dies ist die letzte Instanz vor der Beantragung der Privatinsolvenz. Die Gläubiger haben hierbei nochmals die Möglichkeit, sich zu einigen, wobei der Schuldenberater in den meisten Fällen versucht, die offene Forderung zu reduzieren. Hiermit geben sich die meisten Gläubiger nicht zufrieden und lehnen deswegen diesen außergerichtlichen Einigungsversuch ab und ebnen dadurch den Weg für das Insolvenzverfahren.Wichtig dabei ist die Hinzuziehung eines Schuldenberaters, da dieser unter Umständen den erfolglosen außergerichtlichen Einigungsversuch bei der Antragsstellung vor Gericht bezeugen muss. Wird dieser Schritt vom Schuldner ausgelassen oder vergessen, kann es zu Problemen bei der Antragsstellung führen. Deswegen ist es sehr wichtig, einen Schuldenberater oder eine andere „geeignete“ Person vor der Antragstellung eines Privatinsolvenzverfahrens zu involvieren. Anderenfalls könnten zusätzliche Kosten entstehen, da dem Schuldner der besuch beim Schuldenberater nicht erspart bleibt und er diesen im Nachhinein trotzdem unternehmen muss.
Beispiel einer zusätzlichen Kostenentstehung:
Der Schuldner hat sich mit den Gläubigern in Verbindung gesetzt und mündlich einen außergerichtlichen einigungsversuch gestartet. Diese sind auf diesen Versuch nicht eingegangen beziehungsweise haben ihn abgelehnt. Daraufhin hat sich der Schuldner zum zuständigen Amtsgericht begeben und einen Antrag auf Privatinsolvenz gestellt. Das Gericht hat den Antrag angenommen und geprüft. Daraufhin beantragte das Gericht einen Nachweis über die ergebnislos erfolgte außergerichtliche Einigung. Da der Schuldner diesen Versuch mündlich unternommen hat, kann er seiner Beweispflicht nicht nachkommen, woraufhin das Gericht den Gang zu einem Schuldenberatungsinstitut anordnet. Dort angekommen schildert der Schuldner die Lage und der zuständige Schuldenberater versucht nochmals, eine außergerichtliche Einigung durchzusetzen, was ihm auch gelingt.In diesem Fall hat der Schuldner die Kosten des Schuldenberaters, die außergerichtlich vereinbarten Zahlungen an die Gläubiger sowie die unnötig angefallenen Verfahrenskosten zur Prüfung des Insolvenzantrages zu begleichen. Hätte der Schuldner im Vorfeld einen Schuldenberater aufgesucht, wären ihm die Verfahrenskosten erspart geblieben.
Die Wohlverhaltensphase – was genau ist das?
Nach ungefähr 12-18 Monaten beginnt für den Schuldner die Wohlverhaltensphase. In dieser Zeit zeigt er den zuständigen Behörden, dass er eigenverantwortlich und bewusst mit seinem zu Verfügung stehenden Einkommen wirtschaften kann. In der Wohlverhaltensphase ebbt der Kontakt zum Treuhänder, der während des Verfahrens vom Gericht gestellt wurde, ab und findet nur noch ein bis zwei Mal jährlich statt. Außerdem darf der Schuldner in diesem Abschnitt von seinem pfändungsfreien Einkommen Geld ansparen, welches ebenfalls nicht gepfändet werden darf.Alle Änderungen der wirtschaftlichen und persönlichen Situation des Schuldners sind innerhalb von zwei Wochen beim Treuhänder anzuzeigen. Außerdem muss der Schuldner das pfändbare Einkommen, ebenso wie hälftige Schenkungen, Erbschaften und Sonstiges eigenständig an den Treuhänder abführen. Dieser verteilt die angesammelte Summe ein Mal jährlich zu gleiche Teilen an die vorhandenen Gläubiger.
Die Wohlverhaltensphase dauert zwischen drei und sechs Jahren, wobei sie auf Antrag folgendermaßen verkürzt werden kann:
- Sollte der Schuldner nach 3 Jahren 35 % seiner Schulden zuzüglich der Verfahrenskosten getilgt haben, kann eine vorzeitige Restschuldbefreiung nach 3 Jahren beantragt werden.
- Falls der Schuldner nach 5 Jahren die Verfahrenskosten in vollem Umfang beglichen haben sollte, kann er eine vorzeitige Restschuldbefreiung nach 5 Jahren beantragen.
- In allen anderen Fällen endet die Wohlverhaltensphase automatisch nach 6 Jahren.
Die Restschuldbefreiung – der Start in eine schuldenfreie Zukunft
Übersteht der Schuldner die Wohlverhaltensphase in angemessener Weise, steht einer Restschuldbefreiung nichts mehr im Wege. Diese kann nach 3, 5 oder 6 Jahren der Wohlverhaltensphase beantragt werden. Bei einer Restschuldbefreiung wird der Schuldner von allen übrig gebliebenen Verpflichtungen, die bei Beginn des Insolvenzverfahrens offen waren, gegenüber seinen Gläubigern befreit. Das heißt, dass die Gläubiger keinen Anspruch mehr auf ihr Geld haben, selbst wenn der offene Betrag nicht vollständig getilgt wurde. Mögliche Verpflichtungen aus Verträgen oder Sonstigem, die während der Wohlverhaltensphase eingegangen werden, sind von dieser Regelung selbstverständlich ausgeschlossen und müssen vom Schuldner vertragsgemäß beglichen werden.Sollten die Verfahrenskosten während der Wohlverhaltensphase nicht oder nicht vollständig getilgt worden sein, werden diese nach Beendigung des gesamten Insolvenzverfahrens in Raten fällig. Dabei ist zu beachten, dass der Schuldner sich auf Antrag bei Nachweis eines unzureichenden Einkommens auch von diesen Raten befreien lassen kann. Die Kosten des Schuldenberaters und des Treuhänders, falls dies nicht ein und die selbe Person ist, hat der Schuldner jedoch in jedem Falle zu begleichen.
Ebenfalls sollte beachtet werden, dass Verpflichtungen, die sich aus Straftaten (Steuerhinterziehung, Diebstahl, …) ergeben haben, nicht von der Restschuldbefreiung betroffen sind und in jedem Fall, auch trotz Beantragung eines Insolvenzverfahrens, in vollem Umfang beglichen werden müssen.
whatshot Beliebteste Artikel
- chevron_right Absolute & komparative Kostenvorteile
- chevron_right Der Markt
- chevron_right Stabliniensystem
- chevron_right Arten des Kaufvertrages
- chevron_right Kaufvertrag
- chevron_right AIDA-Modell
- chevron_right Verträge
- chevron_right BWL Grundlagen
- chevron_right Effektivität und Effizienz
- chevron_right Verbrauchsgüter Gebrauchsgüter
category Auch in dieser Kategorie
- chevron_right Objektives Recht
- chevron_right Realakt
- chevron_right Bewegliche unbewegliche Sachen
- chevron_right Umkehrschluss – argumentum e contrario
- chevron_right Bestandteile von Sachen
- chevron_right Relatives Recht
- chevron_right Soziale Bindung des Eigentums
- chevron_right Zwangsgeld