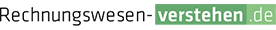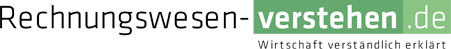Enteignungsgleicher Eingriff
- chevron_right Schutzgut des enteignungsgleichen Eingriffs
- chevron_right Beispiel aus der Praxis:
- chevron_right Voraussetzungen des enteignungsgleichen Eingriffs
- chevron_right Beispiel aus der Praxis:
- chevron_right Enteignungsgleicher Eingriff – das Wichtigste in Stichworten
Eine ausdrückliche, gesetzliche Regelung wurde nämlich nie geschaffen. Amtshaftungsansprüche werden in § 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und Art. 34 GG geregelt. Bei diesen Ansprüchen muss aber immer Verschulden des Hoheitsträgers vorliegen.
Schutzgut des enteignungsgleichen Eingriffs
Im Grundgesetz wird das Eigentum besonders geschützt. Dieser Schutz bezieht sich unmittelbar auf das Verhältnis zum Staat. Würde nun bloß vor schuldhaften Verhalten geschützt, ergäbe sich eine immense Grund- und Menschenrechtsverletzung. Die meisten solcher Verletzungen entstehen nämlich, wenn die Verwaltung ein Gesetz falsch auslegt und rechtswidrig vollzieht. Dann trifft sie zwar kein Verschulden, aber sie handelt rechtswidrig. Beim schlichten Verwaltungshandeln, Realakten, kommt so etwas ebenfalls nicht selten vor.
Beispiel aus der Praxis:
Die Ampel an einer Kreuzung zeigte aufgrund einer technischen Störung in zwei Richtungen ein Grün an. Die Fahrer hielten sich freilich daran und stießen zusammen. Zwar gab es kein Verschulden seitens der Behörde, die Ansprüche ergaben sich aber durch rechtswidriges Verhalten in Form einer Sorgfaltsverletzung. Hier liegt ein enteignungsgleicher Eingriff vor. Dieser Anspruch fängt solche Sachverhalte auf, die ansonsten nicht erfasst wären.
Die Haftung bezieht sich auch auf den Erlass von Regeln, genannt rechtswidriger Erlass untergesetzlicher Normen. Für legislative Normen, also Gesetze, kommt diese Haftungsgrundlage für den Bundesgerichtshof aber nicht in Frage.
Voraussetzungen des enteignungsgleichen Eingriffs
- Eingriff in ein Rechtsgut des Art. 14 GG (siehe oben)
- Eingriff durch hoheitliche Maßnahme inklusive qualifizierter Unterlassung
Eine hoheitliche Maßnahme ist freilich die Voraussetzung, um dem Staat das Verhalten zurechnen zu können. Hier kommt es häufig zu Angrenzungsproblemen.
Qualifizierte Unterlassung meint ein Nichtstun mit Folgen – Extrembeispiel: Wenn ein Polizist einen Mord beobachtet und nicht eingreift, weil es seinen Erzfeind trifft, wäre gesetzlich ein Tun dringend geboten. Hier läge sogar Vorsatz vor.
- Unmittelbarkeit – der Schaden tritt unmittelbar ein und nicht anhand einer Kettenreaktion
- innerer Zusammenhang zwischen Handeln und Schaden
Zusätzlich zur Kausalität, also der Ursächlichkeit eines Handelns für den Eintritt eines Schadens, verlangt der BGH einen „inneren Zusammenhang“: Das kann im Einzelfall sehr schwierig sein und bestimmt sich nach dem konkreten Verantwortungs- und Risikobereich dieses Organs. Hintergrund ist, ob man den Eintritt genau dieser Folge in irgendeiner Art und Weise voraussehen hätte können. Der BGH definiert das Erfordernis so, ob sich mit dem Schaden eine „besondere, typische Gefahr verwirklicht hat, die bereits in der behördlichen Maßnahme selbst angelegt war.“
Beispiel aus der Praxis:
Die Gemeinde betreibt eine Mülldeponie. Dadurch werden typischerweise Krähen und Möwen angelockt. Sie richteten am Nachbarsgrundstück hohe Schäden an (Wintersaat auf Äckern). Der BGH bejahte hier den inneren Zusammenhang.
- Sonderopfer
Hier geht es um das Ausmaß der konkreten Schädigung. Zwar indiziert die Rechtswidrigkeit eines Handelns bereits die Stellung als Sonderopfer. Darum ist diese Voraussetzung meistens kein Problem bei der Geltendmachung dieses Anspruchs. Die Gerichte greifen bei Problemen auf die Sonderopfertheorie, die Situationsgebundenheit und die Schweretheorie zurück.
Enteignungsgleicher Eingriff – das Wichtigste in Stichworten
Folgende Voraussetzungen müssen allesamt vorliegen, um von einem enteignungsgleichen Eingriff sprechen zu können:
- Staatliches Handeln
- schuldlos, aber rechtswidrig
- Beeinträchtigung von Privateigentum
- Unmittelbarkeit des Schadens
- innerer Zusammenhang zwischen Handeln und Schaden
whatshot Beliebteste Artikel
- chevron_right Stabliniensystem
- chevron_right Der Markt
- chevron_right Absolute & komparative Kostenvorteile
- chevron_right Minimalkostenkombination
- chevron_right Inhalt des Kaufvertrages
- chevron_right Verbrauchsgüter Gebrauchsgüter
- chevron_right Arten des Kaufvertrages
- chevron_right Wirtschaftskreislauf
- chevron_right Kaufvertrag
- chevron_right BWL Grundlagen
category Auch in dieser Kategorie
- chevron_right Realakt
- chevron_right Objektives Recht
- chevron_right Bewegliche unbewegliche Sachen
- chevron_right Umkehrschluss – argumentum e contrario
- chevron_right Relatives Recht
- chevron_right Bestandteile von Sachen
- chevron_right Rechtsgleichheit
- chevron_right Was heißt „sui generis“?