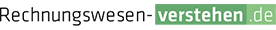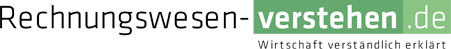Produktinnovation
- chevron_right Beispiel für eine Produktinnovation
- chevron_right Arten der Produktinnovation
- chevron_right Entstehung der Produktinnovation
- chevron_right Unterscheidung nach der Innovationsneigung
- chevron_right Produktinnovation und Qualität des Produkts
Produktinnovation bedeutet in der unternehmerischen Praxis die Einführung eines neues Produktes.
Aus der Sicht des Kunden wird mitunter bereits eine neue Nutzungsmöglichkeit eines bekannten Produkts als neues Produkt gesehen. Eine Produktinnovation aus der Sicht des Unternehmens als produktpolitische Maßnahme setzt aber eindeutige produktionstechnische Veränderungen voraus.
Beispiel für eine Produktinnovation
Die Produktpalette umfasste bisher Mikrowellengeräte. Das Unternehmen entschließt sich, das Sortiment um Multifunktionsgeräte mit Mikrowelle, Backofen und Grill zu erweitern.
Arten der Produktinnovation
Grundsätzlich muss zwischen zwei Arten der Produktinnovation unterschieden werden:
- Unter der Marktinnovation ist zu verstehen, dass ein Unternehmen ein absolut neues Produkt auf den Markt bringt. Dieses war vorher in der Form nicht verfügbar und bringt oft eine zeitlich begrenzte Monopolstellung für das Unternehmen mit sich.
- Die Unternehmensinnovation beschreibt hingegen die Hinzunahme eines Produkts in das Sortiment eines Unternehmens, das zuvor schon bei anderen Anbietern erhältlich war.
Entstehung der Produktinnovation
Produktinnovationen werden von Unternehmen in der Regel recht bewusst herbeigeführt. Durch Forschung und Entwicklung können zum Beispiel neue Alleinstellungsmerkmale für Bestandsprodukte geschaffen werden, die letztlich zu höheren Absatzzahlen führen. Aber auch der allgemeine technische Fortschritt sorgt dafür, dass Unternehmen zur Einführung von Produktinnovationen gezwungen sind.
Der zweite Hauptgrund für die Entstehung von Produktinnovationen liegt in der Veränderung der Nachfrage von Konsumenten. Beispielsweise galt das Auto früher als reines Statusobjekt, weshalb viel Wert auf die Optik und die Leistung gelegt wurde. Heutzutage dient es eher als Nutzobjekt, so dass die Hersteller viele Produktinnovationen auf den Markt brachten.
Beispiele: Navigationssysteme, moderne Bremssysteme und effiziente Motoren mit geringem Verbrauch.
Unterscheidung nach der Innovationsneigung
Die Arten der Produktionsinnovation lassen sich weiter differenzieren. Maßgeblich hierfür ist das Risiko, dass das Unternehmen bei der Entwicklung und der Markteinführung der Innovation eingeht. Dabei gilt: Je größer das Risiko ausfällt, desto höher können die erwirtschafteten Erträge sein.
- Beim Vorreiterverhalten geht das Unternehmen ein hohes Risiko ein und kann viel Kapital verlieren, wenn sich durch die Forschung keine marktfähige Produktinnovation entwickeln lässt. Gleichzeitig besteht die Chance auf eine Abschöpfungspreisstrategie, weil das Unternehmen eine Zeitlang Monopolist wäre.
- Der Frühe Folger hat vergleichsweise wenig Risiko, weil die Fehler des Pioniers bereits bekannt sind. Gleichzeitig bestehen unter Umständen schon gewisse Marktbarrieren, die den effizienten Einstieg verhindern. Zudem entsteht eine Abhängigkeit vom Vorreiter, wenn das Produkt weiterentwickelt werden soll.
- Der Modifikator nutzt die bestehende Produktinnovation und verändert sie geringfügig. Dadurch hat er die Chance, eine Marktnische zu besetzen. Das Risiko besteht allerdings darin, dass diese Nische sehr wenig Flexibilität bietet oder zu klein ist.
- Der Nachzügler hat nur äußerst geringe Forschungskosten. Die Marktrisiken sind klein, weil bereits ein hohes Maß an Informationen über die Nachfrage vorliegt. Gleichzeitig entsteht durch dessen Eintritt eine Gefahr des Preiskampfs. Für den Nachzügler selbst ist es darüber hinaus relativ schwierig, sich auf dem Markt zu etablieren, weil die Konkurrenz deutlich bekannter ist.
Produktinnovation und Qualität des Produkts
Entgegen der landläufigen Meinung führen Innovationen nicht zwangsweise zu einer höheren Qualität des Produkts. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Strategie der gezielten Qualitätsverschlechterung für Güter etabliert. Betroffen sind häufig Luxusgüter, die durch eine Qualitätsverschlechterung deutlich günstiger hergestellt werden können. Dadurch steigt die Nachfrage enorm an, was Massenanfertigungen rentabel macht.
Die Produktverschlechterung ist keineswegs mit der Fälschung von Produkten zu verwechseln. Letztere ist gesetzlich verboten und keine adäquate unternehmerische Strategie.
Ein gutes Beispiel für die bewusste Verschlechterung der Qualität ist Wein. Dieser wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nur in sehr wohlhabenden Kreisen konsumiert, weil die Herstellung äußerst aufwendig war. Weil aber auch in unteren Bevölkerungsschichten durchaus eine Nachfrage nach Wein bestand, stellten einige Weinanbauern ihre Produktion um. Sie ließen den Wein deutlich weniger lange reifen und verschlechterten die Qualität zugunsten der Produktionskosten. Mittlerweile gilt Wein nicht mehr als Luxusgut, sondern ist selbst im Discounter verfügbar.
whatshot Beliebteste Artikel
- chevron_right Absolute & komparative Kostenvorteile
- chevron_right Der Markt
- chevron_right Stabliniensystem
- chevron_right Arten des Kaufvertrages
- chevron_right Kaufvertrag
- chevron_right AIDA-Modell
- chevron_right Verträge
- chevron_right BWL Grundlagen
- chevron_right Effektivität und Effizienz
- chevron_right Verbrauchsgüter Gebrauchsgüter
category Auch in dieser Kategorie
- chevron_right Produktlebenszyklus
- chevron_right Produktelimination
- chevron_right Definition Produkt
- chevron_right Produktvariation
- chevron_right Produktdiversifikation
- chevron_right Produktdifferenzierung
- chevron_right Markenbildung