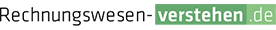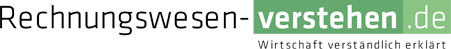Fortführungsprinzip
Fortführungsprinzip verständlich & knapp definiert
Das Fortführungsprinzip gehört zu den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung. Es drückt aus, das Bilanzposten im Sinne einer fortgeführten Geschäftstätigkeit eines Unternehmens bewertet sind, was Auswirkungen auf Steuer- und Handelsbilanz eines Unternehmens hat. Diese Annahme gilt nur, wenn keinerlei Anzeichen einer Insolvenz zu erkennen sind.- chevron_right Welche Auswirkungen hat das Fortführungsprinzip auf die Bewertung?
- chevron_right Fortführungsprinzip in beiden Bilanzen verpflichtend
- chevron_right Welche Umstände können das Fortführungsprinzip aushebeln?
- chevron_right Betriebliche Umstände
- chevron_right Finanzielle Umstände
- chevron_right Fortführungsprinzip – Zusammenfassung
Der Begriff Fortführungsprinzip stammt aus dem Rechnungswesen und besagt, dass bei einer Bewertung immer von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen werden muss, solange dem keine rechtlichen oder tatsächlichen Gegebenheiten im Wege stehen. Das Fortführungsprinzip wird auch „Grundsatz der Unternehmensführung“ oder „Going-Concern-Prinzip“ genannt. Die gesetzliche Regelung zu diesem Prinzip ist in § 252 Abs. 1 Nr. 2 Handelsgesetzbuch nachzulesen.
Welche Auswirkungen hat das Fortführungsprinzip auf die Bewertung?
Dieses Prinzip hat ganz entscheidende Auswirkungen auf die Bewertung. Durch das Fortführungsprinzip müssen Anlagegüter in der Bilanz mit ihrem Anschaffungswert bewertet werden, welcher durch den Abschreibungswert gemindert werden darf. Greift das Fortführungsprinzip nicht, weil beispielsweise die tatsächliche Gegebenheit keine Fortführung der Unternehmenstätigkeit zulässt, sind diese Anlagegüter nur noch mit ihrem Liquidationswert zu bewerten. In der Regel ist dieser jedoch viel niedriger.
Fortführungsprinzip in beiden Bilanzen verpflichtend
Das Fortführungsprinzip ist nicht nur in der Handelsbilanz verpflichtend. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz ist dieses Prinzip auch in der Steuerbilanz anzuwenden.
Welche Umstände können das Fortführungsprinzip aushebeln?
Durch das Institut der Wirtschaftsprüfer gibt es einen Prüfungsstandard (IDW PS 270), nach dem Wirtschaftsprüfer eine Fortführung zur Unternehmenstätigkeit beurteilen. In diesem Standard sind einige Umstände aufgeführt, die ein Aufheben des Fortführungsprinzips möglich machen. Dabei wird zwischen finanziellen und betrieblichen Umstände unterschieden:
Betriebliche Umstände
- Verluste im Hauptgeschäftsfeld oder der Verlust von Hauptlieferanten und -kunden;
- stark angestiegene Personalprobleme oder das Ausscheiden von Führungskräften ohne einen Ersatz;
- Verstoß gegen die Eigenkapitalvorschriften oder fehlende Kontrollen beim Einsatz von Finanzinstrumenten.
Finanzielle Umstände
- Langfristige Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen, ebenso wie kurzfristige Verbindlichkeiten, welche das Umlaufvermögen beträchtlich übersteigen.
- Kredite, die nicht zurückgezahlt werden können.
- Unfähigkeit die Konditionen von Darlehen einhalten zu können, Zahlungen an Gläubiger zu leisten, Kredite sowie Finanzmittel für Produktentwicklungen und wichtigen Investitionen zu beschaffen.
- Erwartete oder schon eingetretene negative Zahlungssalden in der Geschäftstätigkeit.
In der Regel reicht ein Umstand alleine nicht aus, um die Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen zu können.
Fortführungsprinzip – Zusammenfassung
- Das Fortführungsprinzip hat bedeutenden Einfluss auf die Bewertung in Handels- und Steuerbilanz.
- Wirtschaftsprüfer können sich am Prüfungsstandard PS 270 des IDW orientieren.
- Findet das Fortführungsprinzip keine Anwendung, werden Anlagegüter mit ihrem Liquidationswert anstatt ihrem Anschaffungswert bewertet.
whatshot Beliebteste Artikel
- chevron_right Stakeholder und Shareholder
- chevron_right Nachhaltigkeit
- chevron_right Soziale Ziele
- chevron_right Diskontieren
- chevron_right Ökonomie
- chevron_right Schwellenländer
- chevron_right Restbuchwert
- chevron_right Antizyklische Fiskalpolitik
- chevron_right Vertragsfreiheit
- chevron_right Prokura